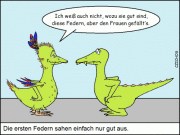Rätsel um Zwergdünen gelüftet

Große Sanddünen wachsen über Zeiträume von Wochen und Jahrzehnten: An kleinen Hindernissen lagern sich nach und nach vom Wind mitgetragene Sandkörner ab. Auf der windzugewandten Luv-Seite wird stetig Sand zum Dünenkamm hinaufgetrieben; über die steilere, windabgewandte Lee-Seite fällt er wieder hinunter. Sandrippel können dagegen deutlich rascher entstehen, es genügen bereits einige Minuten. Weht der Wind abwechselnd aus unterschiedlichen Richtungen, lagern sich schwerere Sandkörner bei gleicher Windstärke schneller ab als leichtere, wodurch sich das bekannte Wellenmuster bildet. „Aber wie es zur Entstehung von sogenannten Megarippeln zwischen diesen beiden Extremen kommt, war bislang ungeklärt“, sagt Klaus Kroy von der Universität Leipzig. Zusammen mit seinen Kollegen untersuchte der Wissenschaftler das Phänomen in der israelischen Negev-Wüste. Zudem entwickelte das Team ein mathematisches Modell, um die Bewegung der Sandkörner in den Rippeln genauer zu erforschen.
„In Megarippeln finden sich sehr unterschiedliche Korngrößen“, erläutert Kroy ein wichtiges Ergebnis der Studie. Die Sortierung der Sandkörner ist hier offenbar noch nicht so stark ausgeprägt wie in anderen Wüsten, in denen keine Megarippel auftreten. Aufgrund dieser Entdeckung vermuten die Wissenschaftler, dass feinere Körner – insbesondere während Erosionsphasen – schnell abgetragen werden und sich größere Körner nach und nach an der Oberfläche sammeln. Fallen nun aufgewirbelte feine Sandkörnchen herab, treiben sie beim Aufprall die gröberen Körner in kleinen Schritten voran. Durch diesen speziellen Transportprozess bilden sich schließlich Megarippel. Damit gebe es deutliche Parallelen zu Dünen, die allerdings aus viel feineren Körnern bestehen. Da Megarippel bei schwachen Winden gar nicht wachsen und bei starken Winden sehr schnell abgetragen werden, sind sie nur in wenigen Wüstenregionen zu finden.
Das neue Modell erklärt nicht nur die Entstehung von Megarippeln. Kroy und seine Kollegen glauben, dass sich Megarippel auch als Archive vergangener Wachstumsphasen in der Erdgeschichte eignen könnten. Ähnlich wie Jahresringe von Bäumen könnte die Schichtung der Körner tiefere Einblicke in die jeweilige Klimageschichte eröffnen. So könnten sie beispielsweise helfen, nach einer Dürreperiode einsetzende Erosionsphasen genauer zu bestimmen. „Die vollständige Entzifferung der Sprache des Sandes dürfte uns aber noch etwas Mühe bereiten“, so Kroy.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit