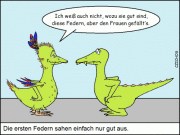Lemuren: Lebenslange Rastlosigkeit lässt Männchen früher sterben

„Wenn man ein sozial lebendes Tier ist und auf eigene Faust in unbekanntes Terrain loszieht, kann es schon mehr als nur eine bloße Herausforderung sein, etwas zu Fressen zu finden“, erläutert Mitautorin Jennifer Verdolin vom National Evolutionary Synthesis Center in Durham. „Noch dazu hat man nicht den Extra-Schutz durch andere Gruppenmitglieder, die dabei helfen können, nach Räubern Ausschau zu halten. Und selbst wenn sich eine neue Gruppe findet, der man sich anschließen kann, muss die Aufnahme möglicherweise erst erkämpft werden, was die Gefahr birgt, bei einem Kampf verletzt zu werden.“ Insbesondere bei älteren Tieren, die nicht mehr so gewandt sind und die sich von Verletzungen nicht mehr so schnell erholen, ist die Suche nach neuen Herausforderungen demnach besonders gefährlich und kann auch tödlich enden.
Gemeinsam mit der Erstautorin Stacey R. Tecot, Anthropologin an der University of Arizona, und weiteren Kollegen hatte Verdolin Daten über das Leben von Edwards-Sifakas (Propithecus edwardsi) analysiert, die über einen Zeitraum von 23 Jahren in einem Nationalpark im Südosten Madagaskars aufgezeichnet worden waren. Das Team betrachtete Geburts- und Todeszeitpunkte von 41 Weibchen und 34 Männchen sowie deren Verhalten bei der Verbreitung. Die Forscher stellten fest, dass Weibchen länger lebten als Männchen – sie wurden maximal 32, die männlichen Lemuren dagegen nur 19 Jahre alt. Im grundsätzlichen Verhalten fanden sich keine Unterschiede, jedoch im Timing über die Lebensspanne hinweg: Während die Weibchen mit etwa 11 Jahren nicht länger in die Fremde zogen, suchten die Männchen ihr ganzes Leben lang immer wieder neue Gruppen auf. Zwischen 13 und 18 stieg ihr Sterberisiko dann merklich an.
Warum die weiblichen Tiere sich endgültig niederlassen und die männlichen nicht, wissen die Forscher bislang nicht. Auf den Menschen sind diese Erkenntnisse sicherlich nicht eins zu eins übertragbar, um als ein weiterer Grund für die unterschiedliche Lebenserwartung von Mann und Frau in Frage zu kommen. Die Forscher geben aber zu bedenken, dass eine mit dem Alter verändernde Risikobereitschaft durchaus auch beim Menschen Einfluss auf die Sterblichkeit nehmen könnte und dies bei bisherigen Untersuchungen nicht in Betracht gezogen wurde.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit