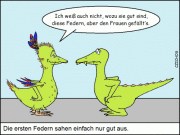Unterscheiden zwischen freundlichem und hämischem Grinsen
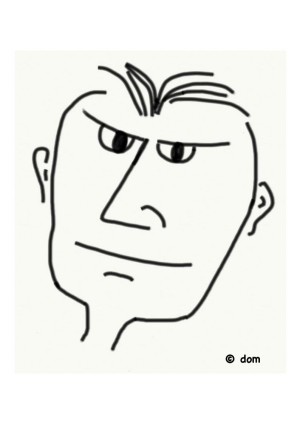
Parallele Hirnscans der Versuchspersonen während der Verhaltensstudie lieferten die Details für das Team um Pascal Vrtička von der Université de Genève. Insgesamt 16 Versuchspersonen sollten ein einfaches Computerspiel spielen, bei dem auftauchende Punkte auf dem Monitor richtig gezählt werden mussten. Unabhängig von der Korrektheit der gegebenen Antwort bekamen die Versuchspersonen ein lächelndes oder ärgerliches Gesicht eingeblendet. Die Wissenschaftler gaben den Versuchspersonen hierzu die Erläuterung, dass es sich um die Reaktionen von Spielern aus anderen Gruppen handele, die im gesamten Spielsystem Gegner oder Partner der Versuchspersonen seien. Wenn also auf die korrekte Antwort einer Versuchsperson ein ärgerliches Gesicht mit der Unterzeile "Gewonnen!" erschien, gehörte dieses Gesicht scheinbar zu einer gegnerischen Spielergruppe. Während des Spiels beobachteten die Forscher die Gehirnaktivität ihrer Probanden mithilfe der Magnetresonanz-Tomografie.
Sahen die eingeblendeten Gesichter glücklich aus, wenn es in der Unterzeile "Gewonnen!" hieß, zeigte sich bei den Versuchspersonen eine erhöhte Gehirnaktivität im ventralen Striatum und dem ventralen tegmentalen Areal, jenen Regionen, die für die Verarbeitung von Belohnungen zuständig sind. Denn das eingeblendete Gesicht wurde als Verbündeter im Spiel erkannt. Hatte eine Versuchsperson in einer Spielrunde nicht richtig geantwortet und es erschien ein ärgerliches Gesicht, dann wurde die Amygdala (Mandelkern) aktiv, in der Furcht und Wachsamkeit verarbeitet werden. Gehörte ein eingeblendetes Gesicht angeblich zur gegnerischen Mannschaft, verarbeitete das Gehirn der Versuchsperson den generischen Gesichtsausdruck im superioren temporalen Sulcus (STS) und dem anterioren cingulären Gyrus. Diese Regionen sind zuständig für die Vorstellungen, die man sich vom Innenleben anderer Menschen macht; in der Hirnforschung werden diese Vorstellungen häufig auch als "Theory of Mind" (TOM) bezeichnet.
In den beobachteten Gehirnaktivitäten zeigte sich nicht nur, wie ein Gesichtsausdruck gedeutet wurde. Wie Vrtička und seine Kollegen darlegen, konnten sie anhand der Gehirnscans auch erkennen, welche Versuchspersonen eher ängstlich auf die Reaktion anderer reagieren oder welche Versuchspersonen sehr darauf bedacht sind, Fehler zu vermeiden. Dadurch liefert die Forschung des Genfer Wissenschaftlerteams die biologische Grundlage für eine Verbindung zwischen dem persönlichen Bindungsstil und der Aktivität im Gehirn.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit