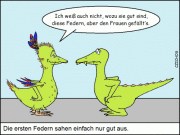Superlinse komprimiert Bilddaten bereits bei der Aufnahme

„Diese Kompression geschieht bereits während der physikalischen Bildaufnahme“, erklären John Hunt und seine Kollegen von der Duke University in Durham. Der Prototyp ihrer Kamera verzichtete dazu auf klassische Linsen. Stattdessen trafen die Millimeterwellen von einem Objekt auf ein Metamaterial, das aus vielen symmetrisch angeordneten, metallischen Ringstrukturen bestand. Solche Metamaterialien werden bisher für den Bau von Tarnkappen genutzt, dienten hier aber als spezieller Wellenleiter. Das Ursprungssignal im Frequenzbereich zwischen 18,5 und 25 Gigahertz wurde dabei so umgewandelt, dass unter Beachtung von Wellenphase und -amplitude ein stark reduziertes Wellenbild entstand. Dieses konnte von einem geeigneten Sensor aufgezeichnet werden und benötigte nur ein Vierzigstel an Speicherplatz im Vergleich zu bisher genutzten Detektoren für diesen Frequenzbereich
Eine spätere Analyse der stark komprimierten Bilddaten zeigte, dass sich die Position von zwei Testobjekten, an denen die Millimeter streuten, genau rekonstruieren ließ. Da jede einzelne Aufnahme zudem sehr schnell binnen einer zehntel Sekunde geschossen und gespeichert werden konnte, ließen sich auch ganze Sequenzen eines sich bewegenden Objekts verfolgen. Das ist besonders für Astronomen interessant, deren Milliwellen-Detektoren bisher nur die Aufnahme einzelner Schnappschüsse und keiner Videosquenzen erlaubten.
Je nach Struktur der genutzten Metamaterial-Linsen lässt sich diese physikalische Kompression von Bilddaten auf andere Wellenlängenbereiche ausweiten. Im Fokus stehen dabei Mikrowellen und Terahertzstrahlung. Im sichtbaren Spektralbereich sind solche Kompressionlinsen zwar auch vorstellbar. Doch müssten dazu erst extrem fein strukturierte Metamaterial geschaffen werden. Ob und wann dieser Schritt für das gesamte, sichtbare Spektrum von Rot bis Violett funktioniert und damit interessant für normale Digitalkameras werden könnte, lässt sich heute noch nicht absehen.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit