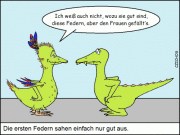Gene des Partners beeinflussen die eigene Gesundheit

„Menschen, die zusammenleben, wissen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Aber sie sind sich nicht bewusst, wie das geschieht“, sagt Amelie Baud vom European Bioinformatics Institute in Hinxton, die Leiterin der Arbeitsgruppe. Wer beispielsweise als Frühaufsteher mit einem Morgenmuffel zusammen wohnt, geht möglicherweise dem Partner zuliebe häufig später schlafen, als es den eigenen Bedürfnissen entspräche. Ein daraus resultierender Schlafmangel könnte also die Ursache einer Erkrankung sein, die sich auf Gene des Partners zurückführen lässt, welche dessen Schlaf-Wach-Rhythmus steuern.
Die Forscher setzten jeweils zwei Mäuse desselben Stammes oder unterschiedlicher Stämme nach der Entwöhnung sechs Wochen lang in einen Käfig. Dann untersuchten sie mögliche Zusammenhänge zwischen Merkmalen der einen Maus und Genen der anderen Maus. Zu den mehr als hundert einzelnen Merkmalen zählten Ängstlichkeit, depressive Stimmung, Bewegungsaktivität, Dominanzverhalten, Wundheilung und Körpergewicht. „Wir fanden heraus, dass der Stamm des Mitbewohners einen überraschend großen Einfluss auf die ermittelten Merkmale hatte“, sagt Baud. Wie weitere Experimente zeigten, ließen sich bis zu 29 Prozent der körperlichen und Verhaltensmerkmale durch soziale genetische Effekte erklären. Am stärksten ausgeprägt waren diese Wirkungen auf die Wundheilung, die Funktion des Immunsystems, die Ängstlichkeit und das Körpergewicht. In einigen Fällen hatten die Gene der Partnermaus sogar einen größeren Einfluss als die eigenen Gene. „Die von uns entwickelten Untersuchungsmethoden könnten sicherlich auch für Studien mit Menschen eingesetzt werden“, sagt Oliver Stegle, ein Mitglied des Forscherteams. Entsprechende Untersuchungen würden Informationen zu Mechanismen und Ursachen von Krankheiten liefern, sagt Baud, die zu neuen Therapien führen können.
Alte Ehepaare: Das Glück des anderen hält gesund
Händchenhalten dämpft den Schmerz
Gesünder leben gelingt eher zu zweit


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit