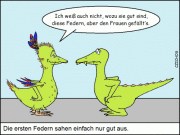Graffiti in Pompeji

"Diese Wände waren riesige Flächen für Botschaften aller Art", erklärt Rebecca Benefiel von der Washington and Lee University. "Es ist wirklich interessant, wie interaktiv die Graffiti waren. Es ist faszinierend, weil sie zeigen, wie engagiert die Menschen beim Schreiben waren. Man las die Botschaften anderer und schrieb Antworten dazu." Mehr als 11.000 Exemplare hat die Forscherin in den letzten drei Jahren untersucht.
Die Graffiti konnten ganz privater Natur sein. So tauschten zum Beispiel ein Mann namens Secundus und eine Frau namens Prima, die an verschiedenen Enden der Stadt wohnten, Liebesschwüre auf Hauswänden aus. Aber auch vor fast 2000 Jahren waren Graffiti schon politisch. Man tat seine Meinung zu den verschiedenen römischen Herrschern frei kund. Damals war - für uns kaum mehr vorstellbar - Kaiser Nero sehr populär. "Neroni feliciter" - frei übersetzt etwa "Lang lebe Nero" - war ein häufiges Graffito in Pompeji. Nachdem Nero seine Frau getötet hatte, schwand seine Popularität zwar, doch machte sich offenbar niemand die Mühe, alte "Neroni feliciter"-Graffiti überzutünchen.
Seltsamerweise hat die Altertumsforschung von den antiken Graffiti bis heute kaum Notiz genommen. So ist Rebecca Benefiel eine von ganz wenigen Wissenschaftlern, die sich damit befassen. Allerdings verbleibt nicht allzu viel Zeit, die Graffiti im Original zu sehen. Denn durch die Sonneneinstrahlung und die Vegetation verblassen und verschwinden die Wandbeschriftungen der freigelegten Ruinenstadt immer mehr. Glücklicherweise haben sich im 19. Jahrhundert Forscher in einem internationalen Projekt die Mühe gemacht, alle lateinischen Inschriften in jedem Land des römischen Reiches - und eben auch die Graffiti in Pompeji - aufzuzeichnen und zu katalogisieren.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit