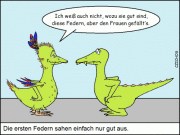Therapie psychischer Störungen: Schadet die Kenntnis biologischer Ursachen?
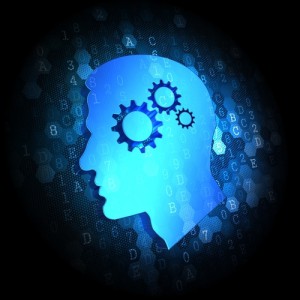
„Biologische Erklärungen sind ein zweischneidiges Schwert“, sagt Matthew Lebowitz von der Yale University in New Haven. “Einerseits verringern sie die Schuld des Patienten an seiner Krankheit. Andererseits können sie entwürdigend sein, indem sie Menschen auf biologische Mechanismen reduzieren.” Genetische Defekte oder Fehlfunktionen bestimmter Hirnzellen seien zwar eine wichtige, aber nicht die alleinige Ursache für die Entstehung komplexer psychischer Erkrankungen.
Zusammen mit Woo-kyoung Ahn erstellte Lebowitz Krankenakten fiktiver Patienten, die an Schizophrenie, einer sozialen Phobie, einer schweren Depression oder Zwangsstörungen litten. Jeden Krankheitsfall stellten sie in zwei Versionen dar: Die eine enthielt Angaben über biologische Faktoren, die für die beschriebenen Symptome verantwortlich waren. In der anderen Version wurden stattdessen psychosoziale Einflüsse wie Kindheitserlebnisse oder Stressbelastungen aufgeführt. Jeder der 237 ausgewählten Therapeuten, darunter Psychologen, Psychiater und Sozialarbeiter, nahm vier dieser Krankenakten zur Kenntnis. In einem standardisierten Test mussten sie danach aus einer Liste Adjektive ankreuzen, die ihre Emotionen zum dargelegten Fall beschreiben. Damit ermittelten die Forscher, wie stark die Probanden Gefühle von Empathie und Unbehagen empfanden. Außerdem gaben die Therapeuten zu jedem Einzelfall an, wie sie Therapiemaßnahmen beurteilten.
Die Auswertung ergab: Die Vermittlung biologischer Krankheitsursachen beeinflusst die Einstellung des Therapeuten zum Patienten stark. Das Mitgefühl verringerte sich, der Einsatz von Medikamenten erschien bei sozialen Phobien und Depressionen eher angebracht und die Effektivität einer Psychotherapie wurde generell geringer eingeschätzt. Eine weitere Studie, in der sowohl biologische als auch psychosoziale Informationen zum Patienten mitgeteilt wurden – wobei aber entweder die einen oder die anderen dominierten – bestätigten die Ergebnisse. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Empathie des Therapeuten mit seinem Patienten entscheidend zum Erfolg der Therapie beiträgt. Und auch bei psychischen Störungen mit bekannten biologischen Ursachen kann eine Psychotherapie sehr nützlich sein.
Von Richtern sei bekannt, so die Autoren, dass sie mildere Urteile über psychisch gestörte Angeklagte fällen, wenn sie die biologischen Ursachen der Krankheit erfahren. In diesem Fall verstärken solche Informationen also das Mitgefühl des Richters. Für das Verhältnis von Therapeut und psychisch krankem Patient gilt dieser Zusammenhang offenbar nicht. Hier bewirkt die Kenntnis über eine biologische Krankheitsursache möglicherweise eine verstärkte Abgrenzung des Patienten von den “normalen” Menschen und ist dadurch mit geringerem Mitgefühl verbunden. “Wir sagen natürlich nicht, dass man biologische Faktoren bei der Erforschung psychischer Störungen ignorieren sollte”, sagt Ahn. Biologische Unterschiede dürften aber nicht dazu missbraucht werden, zwischen “geistig kranken” und anderen Menschen zu unterscheiden.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit