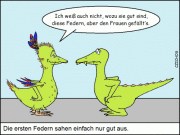Evolution des Menschen: Veränderte Gene schützen vor frühzeitiger Demenz

„Wenn ältere Menschen dement werden, verliert die Gemeinschaft nicht nur wertvolle Quellen von Wissen, Weisheit und Kulturtechniken. Schon ein leichtes Nachlassen kognitiver Fähigkeiten kann bei Menschen in einflussreichen Positionen zu falschen Entscheidungen führen, die allen schaden“, sagt Pascal Gagneux von der University of California in San Diego, der zusammen mit Ajit Varki die Arbeiten leitete. Wie die meisten Wirbeltiere leben die Menschenaffen etwa so lange, wie sie noch Nachwuchs zeugen können. Nur beim Menschen hat sich ein längeres Leben als vorteilhaft erwiesen, weil die Alten die Überlebenschancen des Nachwuchses ihrer Gruppe verbesserten. Doch dieser Vorteil würde normalerweise dadurch verringert, dass bereits ab einem mittleren Alter verstärkt neurodegenerative Erkrankungen auftreten. Daher könnten sich Veränderungen von Genen durchgesetzt haben, die solche Hirnkrankheiten verhindern.
Konkrete Hinweise darauf fanden die Forscher zunächst bei einem Gen, das die Bauanleitung für das Protein CD33 trägt. Dieses Protein sitzt auf der Oberfläche von Immunzellen – auch von Mikrogliazellen des Gehirns. Es trägt dazu bei, Entzündungsreaktionen zu dämpfen. Frühere Untersuchungen hatten ergeben, dass eine bestimmte Variante des CD33-Gens die Ablagerung von Beta-Amyloid-Peptiden im Gehirn verhindert. Solche Ablagerungen sind ein typisches Merkmal der Alzheimer-Demenz. Die Forscher fanden heraus, dass beim Menschen viermal größere Mengen der schützenden CD33-Variante gebildet werden als beim Schimpansen. Ähnliches ergab sich auch für weitere Gene, die das Demenzrisiko senken. So haben sich im menschlichen Erbgut neben dem „Alzheimer-Gen” APOE4 die Varianten APOE2 und APOE3 verbreitet, die einer Demenzerkrankung entgegenwirken. Die neuen Ergebnisse würden zwar keinen direkten Beweis dafür liefern, dass die schützenden Genvarianten durch diese Form der Selektion entstanden sind, sagt Gagneux. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Vorteil einer längeren Lebensdauer sei aber naheliegend.
Ganz allgemein sorgt die natürliche Selektion dafür, dass sich die Zahl der überlebenden Nachkommen erhöht. Eventuell schädliche Folgen für das Überleben im Alter spielen dabei keine Rolle. Geistig fitte Omas und Opas haben sich aber beim Menschen offenbar als so vorteilhaft für die Überlebenschancen der Nachkommen erwiesen, dass in diesem speziellen Fall die Evolution zu einer verlängerten Lebensdauer führte. In heutigen Völkern von Jägern und Sammlern haben nach Angaben der Autoren etwa ein Drittel aller Frauen die Wechseljahre bereits überschritten. Bei Schimpansen ist der Anteil alter Weibchen viel geringer, da die weiblichen Tiere meist sterben, kurz nachdem sie unfruchtbar geworden sind. Im Erbgut des Neandertalers liegt die beim Homo sapiens veränderte Version des CD33-Gens noch nicht vor. Dieser Evolutionsprozess begann demnach erst, nachdem die beiden Menschenarten begonnen hatten, sich auf getrennten Wegen weiterzuentwickeln.
Oma sei Dank: Evolution der Paarbindung beim Menschen
Am Anfang war die Oma


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit