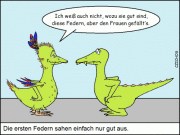Chicxulub – Wie der Asteroiden-Krater vor 66 Millionen Jahre kollabierte

„Es ist kaum zu glauben, dass die gleichen Kräfte, denen die Saurier zum Opfer fielen, eine Rolle für das spätere Leben auf der Erde spielen könnten“, sagt Geophysikerin Joanna Morgan vom Imperial College London. Diese Annahme gründet auf der Analyse von Bohrkernen, die das internationale ECORD-Konsortium auch unter Beteiligung deutscher Forscher aus Hamburg und Bremerhaven aus Gesteinsschichten 500 bis 1300 Meter unter dem Meeresboden gezogen haben. Denn die Bohrkerne zeigten sich überraschend porös und könnten in ihren Poren Platz für einfache Organismen und Nährstoffe geboten haben.
Die Struktur und Zusammensetzung der Bohrkerne erlaubte es den Forschern auch in Kombination mit geologischen Modellen, die Dynamik des Einschlags zu rekonstruieren. Der etwa zehn Kilometer durchmessende Asteroid setzte beim Auftreffen eine geschätzte Energie von mehr als 400 Zettajoule frei. Das entspricht mehr als einer Milliarde Atombomben, die 1945 Hiroshima und Nagasaki zerstörten. Unmittelbar nach dem Einschlag wurden Gesteinsmassen bis in mindestens zehn Kilometer Tiefe erst nach unten und dann nach außen gepresst. Danach bewegten sie sich wie eine Welle wieder in die Einschlagszone hinein und wölbten sich nach oben. Diese Aufhäufung kollabierte kurz darauf ein und hinterließ etwa zehn Minuten nach dem Einschlag am Rand des Kraters die steinige Ringstruktur – Peak-Ring genannt.
Abgeschlossen sind die Untersuchungen noch nicht. So spüren die Forscher in ihren Proben noch weiteren Hinweisen nach, um eine mögliche Entwicklung von Leben in den porösen Gesteinsstrukturen entlang des Kraterrings belegen zu können. Auch Tsunamiwellen, die sich nach dem Einschlag über das Meer bewegten, könnten dabei ein wichtige Rolle gespielt haben. Insgesamt liefert diese Bohrexpedition die bisher wertvollsten Daten zur Entstehung von Asteroiden-Kratern auf der Erde. Nach ihrem Vorbild könnten nun weitere Expeditionen zu anderen Einschlagkratern auf der Erde folgen.


 Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten
Was Sie schon immer über Mikroben wissen wollten Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien
Energiewende: Schluss mit Schwarz-Weiß-Strategien Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit
Nicole Bender und Lotte Habermann-Horstmeier: Evolution und Gesundheit